Abschnitt 8.1 setzt sich mit dem für das Buch zentralen Begriff der Verbindung auseinander. Dieser beschreibt etwas Ähnliches wie eine Beziehung, erlaubt aber mehr Flexibilität, welche Personen in welcher Weise einbezogen werden. Zudem haben Verbindungen immer einen inklusionslogischen Kern, es gibt also (reine) Exklu-Beziehungen, aber keine (reinen) Exklu-Verbindungen. Mit Bezug auf Adamczak (BR) wird der konzeptionelle Ausgangspunkt einer Utopie und somit der entsprechenden Transformation in den Verbindungen bzw. Beziehungen der Menschen lokalisiert. Dabei werden einerseits die Vorteile gegenüber einer tätigkeitsorientierten Utopie aufgezeigt, und andererseits, warum der Verbindungsbegriff für diese Konzeption noch geeigneter ist als der Beziehungsbegriff.
In 8.2 wird die Bedürfniskonzeption der Kritischen Psychologie diskutiert, d.h. die Unterscheidung zwischen produktiv und sinnlich-vital, und der unterschiedliche Gebrauch dieser Kategorien bei H.-Osterkamp und Holzkamp (nämlich, dass H.-Osterkamp produktive und sinnlich-vitale Bedürfnisse unterscheidet, Holzkamp hingegen produktive und sinnlich-vitale Aspekte aller Bedürfnisse). Mit Verweis auf die Sinnliche Erkenntnis (SE) wird argumentiert, dass die Sichtweise von der Dimension des Genusses und der Dimension der Verfügung nicht weit genug geht, da der Genuss selbst auch wiederum produktiv ist, und sich die produktiven Aspekte der Bedürfnisse nicht nur auf den bewerteten Zustand selbst, sondern auf die gesamte persönliche Handlungsfähigkeit beziehen sollten.
Abschnitt 8.3 führt schließlich das Konzept der Bedürfnisse in Verbindung ein, welches einen Paradigmenwechsel weg von Bedürfnissen als Eigenschaften des Individuums hin zu Eigenschaften von Verbindungen begründet. Nach dieser Konzeption von Verbindungsbedürfnissen habe in aller Regel nicht ich* ein Bedürfnis, sondern es gibt immer ein wir*, das etwas will; das Bedürfnis existiert nicht ohne die Verbindung und kann nur in der Verbindung vollständig befriedigt werden. Ausnahmen hiervon sind lediglich die rein körperlichen (sinnlich-vitalen) Bedürfnisse sowie das abstrakte Bedürfnis nach Verbundenheit selbst. Umgekehrt existiert auch keine Verbindung ohne die gemeinsamen Verbindungsbedürfnisse: Die Bedürfnisse sind die Verbindung. Zum Abschluss wird das Konzept an den Beispielen des Arbeitsmarkts, des Warenmarkts und der Werbung illustriert.
In 8.4 wird schließlich genauer untersucht, wie sich Verbindungsbedürfnisse jeweils für das Individuum und in der Verbindung in Form von Wünschen, Visionen und Zielen manifestieren. Zentral ist hierbei der Gedanke, dass die Vorstellungen, die das Individuum von der sozialen Erfüllung hat, noch nicht selbst seine Bedürfnisse sind, sondern vielmehr Kompetenzen darstellen, um in der Verbindung die eigentlichen Bedürfnisse erst noch herauszubilden.
8.1 Verbindungen
8.1.1 Die beziehungsorientierte Utopie
Bei einer arbeitsorientierten Utopie, wie wir sie ganz klassisch z.B. aus dem utopischen Sozialismus kennen (vgl. Buber 1958), ist meine* erste Entscheidung stets, welche Tätigkeit ich* ausführen werde; folglich wird mein* soziales Umfeld, mein* Beziehungskomplex dann im Wesentlichen dadurch bestimmt, welche Anderen ich* bei meinen* Tätigkeiten so treffe; auch ist die Qualität der Beziehungen, die Beziehungsweise, wesentlich davon abhängig, welche Arten sich zu verbinden durch die Tätigkeiten und deren Organisation nahegelegt werden.
Die Arbeit auf diese Weise in den Mittelpunkt des Lebens zu rücken, stellt die Zweck-Mittel-Umkehr des Exklu-Systems dar (vgl. Krisis 1999); diese Fetischisierung darf in der Utopie nicht reproduziert werden. Vielmehr braucht es eine erneute Umkehr in die andere Richtung, eine Negation der Negation.
Die Organisation der Gesellschaft und die Integration der Menschen in die Gesellschaft muss sich also an dem festmachen, was das gesellschaftliche Leben tatsächlich ausmacht, also wofür es sich zu leben lohnt; dies darf nicht länger als by-product von gesellschaftlichen Pflichten gehandhabt werden, sondern muss zur offiziellen Hauptsache erklärt werden.[1]
Wir brauchen also eine Zweck-Mittel-Umkehr [dahingehend], dass all das, was im Kapitalismus zur Hintergrundbedingung und zum Mittel (für die Reproduktion der Arbeitskraft) degradiert ist – Essen, Wohnen, Lernen, Ausruhen, Entfalten, Gestalten, Spaß haben, mit sich selbst und anderen klarkommen – in einer vernünftigen Gesellschaft zum Selbstzweck wird. (Lutosch 2021)

Es braucht eine beziehungs- bzw. verbindungsorientierte Utopie, bei der anstelle meiner* Arbeit an erster Stelle die Menschen stehen, mit denen ich* verbunden bin oder sein möchte. Die Verbindung darf nicht Mittel zum Zweck sein; sie darf auch keinen Zweck voraussetzen, der die Verbindung zusammenhalten muss, sondern sie muss selbst der ultimative Zweck sein, aus dem alles andere entspringt:
Die freie Assoziation bildet … nicht nur Mittel, sondern zugleich Zweck und Lebensatmosphäre [der] Bedürfnisbefriedigung. Das unterscheidet … die Bestätigung kommunistischer Beziehungen von zusammenhaltenden externen Zielen, wie dem Wohl einer Nation, dem Königreich Gottes usw. Das Ziel der menschlichen Beziehung liegt nicht außerhalb von ihnen, sondern innerhalb. … Es ist keine innermenschliche Natur, die veräußerlicht und verwirklicht zu werden braucht. Es ist die zwischen den Menschen liegende Beziehung, die das Ziel der Beziehung darstellt. (BR 271f)
Diese Beziehungen der Inklu, die zum Selbstzweck existieren und die Organisation des gesamten Gesellschaftssystems aus sich heraus bedingen, müssen sich von allen im bestehenden System bekannten Beziehungsweisen abheben, oder anders ausgedrückt, sie müssen die verschiedenen, einseitig-funktionalen bestehenden Beziehungen in sich aufheben. Das heißt, dass Beziehungen, um menschlich zu sein, ebenso sehr freundschaftlich und liebevoll wie materiell gesättigt sein müssten (BR 272), weshalb [d]ie revolutionäre Rekonstruktion … nicht bei den Beziehungsweisen Ware und Liebe, Markt und Familie verharren [kann], sondern [sie] wird zugleich die Beziehungsweisen Staat, Bürokratie, Partei, Verein, Freund*innenschaft durchkreuzen, mischen, rekombinieren, kurz queeren wollen. (BR 285)
8.1.2 Der Verbindungs-Begriff
Der Begriff der Beziehung(sweise) ist besser geeignet um über Utopie und Transformation nachzudenken als eine Auflösung der Gesellschaft in Individuen. Er ist aber noch nicht ideal. Denn eine Beziehung wird in der Regel als (nur) zwischen zwei Menschen bestehend gedacht (oder zwischen zwei Gruppen, Parteien, Partner*innen). Wenn auch in Ausnahmefällen mal von einer Beziehung zwischen mehr als zweien gesprochen wird, so handelt es sich dabei doch stets um einen geschlossenen Personenkreis, um eine Clique, in der (undifferenziert) jede*r auf jede*n bezogen ist.

Die Untersuchung von Beziehungen suggeriert also nach wie vor eine Art von Vereinzelung, in dem Sinne dass die Gesellschaft in Cliquen aufgelöst wird, die voneinander nichts wissen.
Am offensichtlichsten wird dies am Beispiel der Sphärentrennung (i.e.S.): Wir* sind in verschiedene berufliche und private Beziehungscliquen involviert; die beruflichen und privaten wissen aber voneinander nichts (bzw. kaum etwas) und beziehen die Bedürfnisse der jeweils anderen Cliquen nicht ein. (Dies wird in Kapitel 14 noch ausführlich diskutiert.)
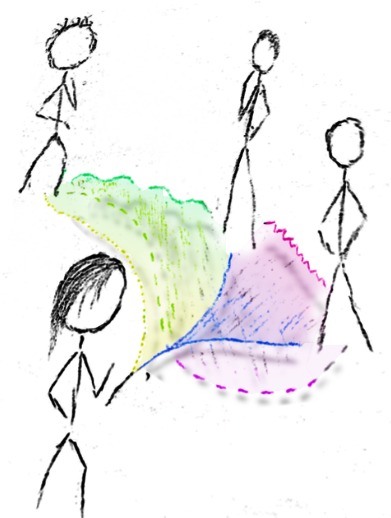
Mit dem Beziehungsbegriff kann daher der Umstand nicht erfasst werden, dass zwei Menschen, zu denen ich* jeweils eine intensive Beziehung pflege, untereinander eine ebenso intensive Beziehung haben können, oder eine wesentlich lockerere, oder aber gar keine; oder dass zwei Menschen, zu denen ich* in sehr unterschiedlichen Beziehungen stehe, untereinander selbst eine Beziehung der einen oder der anderen Art haben können, oder eine ganz andere, oder gar keine. Und wenn zwischen ihnen eine Beziehung besteht, dann kann diese aus demselben Grund bestehen wie die Beziehungen mit mir*, aus einem *verwandten* Grund oder aus einem völlig anderen.
Wenn die anderen ebenfalls in einer Beziehung stehen, dann ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile: Es bestehen dann nicht bloß drei einzelne Beziehungen zwischen je zwei Personen, sondern diese Beziehungen sind selbst wiederum aufeinander bezogen. Es kann z.B. auch sein, dass eine Beziehung durch eine andere Beziehung vermittelt ist (siehe Kapitel 5 und 10); dann gehören die Einzelbeziehungen zu einem Beziehungs-Gesamtgeflecht, haben aber darin sehr unterschiedliche Rollen. Es folgt also nicht, dass wir* alle drei in einer Beziehung stehen, da ja Beziehungen gänzlich unterschiedlicher Qualität hier involviert sein können. Das Ganze stellt etwas Beziehungsartiges dar, ist aber selbst keine Beziehung im gebräuchlichen Sinne.

Der Begriff der Verbindung (oder Verbundenheit, sozialer Kontext) durchbricht die Enge, die Eingeschworenheit, die Verschlossenheit und Mystik der Beziehungen. Da Verbindungen selbst in Verbindung stehen, somit Teil von größeren Verbindungen sein können und sich zu größeren Verbindungen vereinigen können, kommt im Verbindungsbegriff die gesellschaftliche Eingebundenheit der Beziehung zum Ausdruck, also ihre Vermitteltheit; damit die grundsätzlich transpersonale Natur aller Beziehungen (siehe Kapitel 10). Es ist diese Vermitteltheit – der Gedanke, die Beziehung nicht in Isolation, sondern selbst in Beziehung bzw. Verbindung zu betrachten, der uns aufzeigt, wodurch ihre Charakteristik zustande kommt und welche Mittel zu ihrer Gestaltung zur Verfügung stehen. Hinter jeder Beziehung (mit inklusionslogischem Kern, siehe gleich) steht also eine Verbindung, die über die bloße (isolierte) Beziehung hinausgeht.
Und noch eine wesentliche Unterscheidung wollen wir zwischen Verbindungen und Beziehungen treffen: Verbindungen sind grundsätzlich – zumindest teilweise – positiv, haben einen inklusionslogischen Kern, der in gemeinsamen Bedürfnissen, genannt Verbindungsbedürfnisse besteht (Verbindungsbedürfnisse werden in Abschnitt 8.3 im Detail erläutert). Diesen inklusionslogischen Kern der Verbindung bezeichnen wir auch als Verbindung i.e.S.. Alle Verbundenheit i.e.S. ist somit Inklu.
Um überhaupt eine Verbindung zu konstituieren, braucht es also einen inklusionslogischen Kern. Es gibt somit keine rein antagonistischen Verbindungen. Von daher bin ich* mit den Menschen am anderen Ende der Welt, die für die Herstellung meiner* Produkte ausgebeutet werden, nicht verbunden, wohl aber mit jenen, die unter fairen Bedingungen ohne Zwangslage für mich* produzieren, weil sie (auch) selbst ein Bedürfnis haben, das Produkt zu schaffen, bzw. es in einer bestimmten Herstellungsweise zu schaffen etc., wenn dies Vorstellungen sind, die meinen eigenen entsprechen und einen gemeinsamen Ursprung mit ihnen haben.
Es sollte aber auch klar sein, dass zu jeder Verbindung neben dem inklusionslogischen Kern auch rein organisatorische, vermutlich sogar rivale Aspekte gehören. Sie gehören insofern zur Verbindung, als dass sie materielle Grundbedingungen oder Störfaktoren darstellen, mit denen sich die Verbindung auseinandersetzen muss. Die Verbindung mitsamt all diesen Facetten bezeichnen wir entsprechend als Verbindung i.w.S.
Verbundenheit ist also immer auch inklusionslogisch, da sie einen inklusionslogischen Kern, die Verbindung i.e.S. beinhaltet. Wir können aber die Inklu-Dimensionen aus Kapitel 1 heranziehen, um zu analysieren, wie inklusionslogisch die Verbindung i.e.S. tatsächlich ist. Wir würden dann von einer Inklu- oder Exklu-Verbindung i.e.S. sprechen, je nachdem, auf welcher Seite der vier Dimensionen wir uns überwiegend befinden.
Wenn wir hingegen von einer Inklu- oder Exklu-Verbindung i.w.S. sprechen, dann ist damit im Wesentlichen (auch) gemeint, welchen Raum der inklusionslogische Kern innerhalb der gesamten Verbindung i.w.S. einnimmt, also wieviel Exklusionslinien für den inklusionslogischen Kern der Verbindung in Kauf genommen werden müssen.
Exklu-Verbundenheit ist das (häufige) Phänomen, irgendwo einen Kern einer Verbindung zu haben, den es zu bewahren gilt, diesen jedoch gegen immerwährende Konflikte, Machtgefälle, Einschränkungen, Ohnmächtigkeiten, Gefahren etc. verteidigen zu müssen.
8.2 Bedürfnisse in der Kritischen Psychologie
Die Bedürfnisse eines Individuums bestimmen den eigenen inneren Zustand und die resultierende Handlungsbereitschaft – artikuliert etwa als Wunsch, Streben, Antrieb oder Verlangen. (KA 122) In diesem Sinne wird das Wort Bedürfnis in diesem Buch als Oberbegriff für sämtliche Wollensdispositionen verwendet, sowohl im Sinne des Bestrebens als auch des Befindens.
Mit menschlichen Bedürfnissen hat sich die Kritische Psychologie, ausgehend von Ute H.-Osterkamps Grundlagenwerk (M II) hinlänglich auseinandergesetzt. Zentral ist die Differenzierung zwischen sinnlich-vitalen und produktiven Bedürfnissen:
[A]uf der einen Seite stehen die Bedürfnisse, die die emotionale Grundlage für Kontrolle [sic] der Lebensbedingungen, d.h. – auf menschlichem Niveau – für die Tendenzen zur Teilhabe an gesellschaftlicher Realitätskontrolle und kooperativer Integration bilden. Dieses Bedürfnissystem wird von uns mit dem Terminus der
produktivenBedürfnisse umschrieben. DieproduktivenBedürfnisse sind auf den Erwerb der Kontrolle über die relevanten Lebensbedingungen gerichtet und umfassen alle Tendenzen zur Ausdehnung bestehender Umweltbeziehungen, somit also auch der sozialen Beziehungen, und zwar in ihrem Doppelaspekt: als Teil der zu erkundenden Umwelt, aber auch als über die Kooperationsbeziehung ermöglichte Erweiterung der Basis dieser Umweltbegegnung und Erhöhung der damit verbundenen Erlebnisfähigkeit… .Den
produktivenBedürfnissen stehen als zweites Bedürfnissystem Bedürfnisse gegenüber, die sich nicht auf die gesellschaftliche Absicherung der individuellen Existenzerhaltung beziehen, sondern in denen sich die individuellen Mangel- und Spannungszustände selbst ausdrücken, für deren Reduzierbarkeit durch die Teilhabe an gesellschaftlicher Realitätskontrolle vorgesorgt werden soll, die also Indikatoren für die unmittelbare Gefährdung, Beeinträchtigung o.ä. der individuellen Existenz sind. Diese Art von Bedürfnissen … sollen alssinnlich-vitale Bedürfnissebezeichnet werden[.] (M II, 22, Umbruch hinz.)
Die sinnlich-vitalen sind also die unmittelbaren, physischen Bedürfnisse, während die produktiven Bedürfnisse auf einer höheren Meta-Ebene angesiedelt sind, d.h. sich auf Sicherung der zukünftigen Erfüllung anderer (produktiver oder sinnlich-vitaler) Bedürfnisse (Kontrolle über die Lebensbedingungen) richten bzw. dazu geeignet sind, diese zu gewährleisten.
Anders als der Name vermuten lässt, müssen sich produktive Bedürfnisse demnach nicht darauf richten, tatsächlich etwas zu produzieren bzw. einen (produktiven) Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Vielmehr sollte das Adjektiv produktiv hier so verstanden werden, dass diese Bedürfnisse produktiv für das Subjekt selbst sind. Insbesondere sind unter die produktiven auch sämtliche sozialen Bedürfnisse zu fassen:[2]
Wir hatten deshalb auch die Termini
gesellschaftsbezogene Bedürfnisseund die SammelbezeichnungKontroll- und Sozialbedürfnissein Erwägung gezogen, aber als zu global bzw. zu wenig aussagekräftig wieder verworfen. Der Begriffproduktive Bedürfnisse… ist nur richtig zu verstehen, wenn man sich deutlich macht, daß damit die phylogenetisch gewordene und gesellschaftlich entwickelte selbständige Bedürfnisgrundlage für individuelle Beiträge zu gesellschaftlicher Realitätskontrolle, also in diesem Sinne das subjektive Bewegungsmoment gesellschaftlicher Produktion gemeint ist; dabei sind aber, wie sich zeigen wird, die Möglichkeiten zur gesellschaftlich vermittelten Verbesserung der Kontrolle über die eigenen Lebensbedingungen und Integration, damit zuproduktiverBedürfnisbefriedigung, nicht nur innerhalb des gesellschaftlichenProduktionsbereichsgegeben, sondern auch in Lebenssituationen außerhalb der Produktion, z.B. der kindlichen Vergesellschaftung alsVorbereitungsphase, aber auch in der »symbolischen« Teilhabe an kumulierter gesellschaftlicher Erfahrung bzw. in Beiträgen zu ihrer Verdichtung und Verallgemeinerung in künstlerischer Rezeption bzw. Aktivität, etc. (M II, 23)
Letztendlich kann die individuelle Sicht auf Produktivität aber wohl mit gesellschaftlicher Produktivität – zumindest in einem beschränkten sozialen Umfeld – gleichgesetzt werden, da sich die eigenen Bedürfnisse nicht ohne Einbindung in das soziale Umfeld und damit Erbringung eines (wie auch immer gearteten) gesellschaftlichen Beitrags erfüllen lassen werden:
Wenn wir dergestalt die
produktivenBedürfnisse in ihrem Verhältnis zu denSinnlich-vitalenBedürfnissen als Spezifikum der menschlichen Bedürfnisverhältnisse herausgestellt haben, so sind, wenn dies richtig verstanden werden soll, zuvorderst zwei Arten von Mißverständnissen zu vermeiden: Zum einen darf man dieproduktivenBedürfnisse nicht als verselbständigtesProduktionsbedürfnis, Bedürfnis der Individuen zumProduktivseinetc., etwa nach Art des humanistisch-psychologischenWachstums– oderSelbstverwirklichungs-Bedürfnisses, mißdeuten. MitProduktionist in unserem Terminus nicht irgendeine individuell-kreative Aktivität, sondern der gesamtgesellschaftliche Produktions- und Reproduktionsprozeß angesprochen, und die Bedürfnisgrundlage der individuellen Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Produktions-/Reproduktionsprozeß ergibt sich aus dem Umstand, daß auf der Stufe gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit individueller Existenz das Individuum nur auf diesem Wege (nach Maßgabe seiner Lage- und positionsspezifischen Möglichkeiten) Verfügung über seine eigenen relevanten Daseinsbedingungen und Lebensquellen erreichen kann. Die individuelle Produktivität verschiedener Art ist demgegenüber lediglich ein möglicher Ausdruck der über den Beitrag zur verallgemeinert-gesellschaftlichen Lebensgewinnung und -entfaltung zu entwickelnden personalen Handlungsfähigkeit, also eine besondere Realisierungsform produktiv-sinnlicher Bedürfnisse.Zum anderen darf die genetische Herkunft der
produktivenBedürfnisse aus dem geschilderten globalenKontrollbedarfnicht zu dem Fehlschluß verleiten, dasproduktiveBedürfnis sei einfach einKontrollbedürfnis, der Mensch habe genuin den Antrieb, seine Lebensbedingungen zukontrollieren, o.ä.. Wie unsere Analyse ergab, hat sich der gelernteKontrollbedarfmit der Herausbildung und Durchsetzung der gesellschaftlichen Lebensgewinnungsform verallgemeinerter Vorsorge etc. ja gerade zur Bedürfnisgrundlage einer qualitativ neuen,menschlichenExistenzweise, nämlich der bewußten Verfügung über die eigenen Lebens- und Befriedigungsquellen, entwickelt. Die Teilhabe an der Verfügung (Kontrolle) über die gesellschaftlichen Lebensbedingungen ist also kein Selbstzweck, sondern wesentliche Qualität dermenschlichenWeise individueller Bedürfnisbefriedigung und Daseinserfüllung. WoKontrollesich als individuelles Streben verselbständigt, ist dies hingegen ein spezielles Symptom der Isolierung des Individuums von den gesellschaftlichen Verfügungsmöglichkeiten, damit Möglichkeiten der Angstüberwindung, also gerade der personalen Unfähigkeit, wirkliche Verfügung über die relevanten Lebensbedingungen, damitmenschlicheLebensqualität zu erlangen [vgl. dazu H.-Osterkamp 1983].Zur Zuspitzung dieser Ausführungen läßt sich der berühmte Marxsche Satz von der Arbeit als
erste(s) Lebensbedürfnis(MEW 19, S. 21) durch folgenden Kommentar aller Mißdeutungen entheben: Nicht dieArbeitals solche ist erstes Lebensbedürfnis, sondernArbeitnur soweit, wie sie dem Einzelnen die Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozeß erlaubt, ihn alsohandlungsfähigmacht. Mithin ist nichtArbeit, sondernHandlungsfähigkeitdas erste menschliche Lebensbedürfnis – dies deswegen, weil Handlungsfähigkeit die allgemeinste Rahmenqualität eines menschlichen und menschenwürdigen Daseins ist, und Handlungsunfähigkeit die allgemeinste Qualität menschlichen Elends der Ausgeliefertheit an die Verhältnisse, Angst, Unfreiheit und Erniedrigung. (GdP 242f, tw. zit. in GL Kap. 9.4 & Markard 2009, 198)
Holzkamp verwendet die Begriffe produktiv und sinnlich-vital in Bezug auf Bedürfnisse in einem ähnlichen, aber leicht abgewandelten Verständnis von H.-Osterkamp. So kennzeichne[t] [er] in Übernahme dieser Terminologie den kooperativen bzw. primären Aspekt der Bedürfnisverhältnisse … in ihrer Besonderheit auf der Stufe gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit individueller Existenz als produktiven und sinnlich-vitalen Aspekt menschlicher Bedürfnis-Verhältnisse. (GdP 242, Herv. orig.)
Bedürfnisse werden also nicht in sinnlich-vitale und produktive eingeteilt, sondern alle Bedürfnisse besitzen neben der sinnlich-vitalen Dimension des Genusses immer auch die produktive Dimension der Verfügung. Aktuell vorhandenes Essen genießen zu können, ist die eine Seite, dauerhaft über Essen verfügen zu können, die andere. … Hunger scheint bloß sinnlich-vital zu sein, aber Hunger gewinnt v.a. dann seine zerstörerische Kraft, wenn ich keine Möglichkeiten habe, durch soziale Teilhabe über meine Lebensbedingungen so zu verfügen, dass ich in Zukunft keinen Hunger mehr haben muss. (KA 127f, Herv. geändert)
Aber auch diese Interpretation der Termini produktiv und sinnlich-vital kann noch nicht die ultimative Wahrheit sein, denn auch der Genuss, also das Sinnliche selbst, ist bereits produktiv, also auf Erweiterung der Handlungsfähigkeit ausgerichtet, so die Rubinsteinsche Beobachtung, welche in Holzkamps Sinnlicher Erkenntnis (SE) aufgegriffen wird:
Die menschliche Wahrnehmung ist gegenständlich und sinnerfüllt. Sie läßt sich nicht auf eine nur reizmäßige Grundlage reduzieren. Wir nehmen nicht Empfindungsbündel und nicht
Strukturenwahr, sondern Gegenstände, die eine bestimmte Bedeutung haben.Praktisch ist für uns gerade die Bedeutung des Gegenstandes wesentlich, weil sie seine Verwendbarkeit kennzeichnet: Die Form hat keinen eigenständigen Wert. Sie ist in der Regel nur wichtig als Merkmal für die Erkenntnis des Gegenstandes in seiner Bedeutung, das heißt für die Erkenntnis seiner Beziehungen zu anderen Dingen und seiner Verwendbarkeit. … Da die Wahrnehmung des Menschen ein Bewußtwerden des Gegenstandes ist, schließt sie normalerweise den Akt des Verstehens und der Sinnerfüllung ein. Die Wahrnehmung des Menschen umschließt die Einheit des durch die Sinne Gegebenen und des Logischen, des durch die Sinne Gegebenen und des Sinnvollen, der Empfindung und des Denkens.
Der sinnliche und der sinnvolle Inhalt der Wahrnehmung sind dabei nicht einander nebengeordnet. Der eine baut sich nicht äußerlich auf dem anderen auf. Sie bedingen und durchdringen sich wechselseitig. Vor allem stützt sich der Sinngehalt, die Bedeutung des Gegenstandes, auf den sinnlichen Gehalt, geht von ihm aus und ist nichts anderes als die Sinnerfüllung des gegebenen sinnlichen Inhalts. (Rubinstein 1958, 319, tw. zit. in SE 25)
Gegenstandsbedeutung heißt … Bedeutung im Zusammenhang mit der menschlichen Lebenstätigkeit. Ein
Hammerbeispielsweise ist nicht lediglich Inbegriff einer bestimmten Form und bestimmt gearteten Farbigkeit, sondern eine komplexe gegenständliche Bedeutungseinheit, in die eingeht, daß er von Menschen gemacht ist, daß er zum Schlagen da ist, wie man am besten mit ihm trifft, daß man mit ihm vorsichtig sein muß u.v.a., wobei all dies einheitliches und eindeutiges Gesamtcharakteristikum des Hammers als eines wirklichen, wahrnehmbaren Dinges ist. …Gegenstandsbedeutungen werden nicht
vorgestelltodergedacht, sie werden im eigentlichen und engsten Sinne wahrgenommen. Die gegenständliche Bedeutungshaftigkeit ist keineswegs von der sinnlichen Präsenz und dem Empfindungscharakter der Wahrnehmungsgegebenheiten zu trennen. …Die Feststellung, daß die Gegenstandsbedeutung nicht zu den figural-qualitativen Merkmalen hinzukommt oder umgekehrt, ist so wörtlich wie möglich zu nehmen. Die figural-qualitativen Eigenarten eines Wahrnehmungstatbestandes machen vielmehr seine Gegenstandsbedeutung aus. Der Hammer dort ist nichts anderes als eben jenes Ding mit dieser bestimmten figural-qualitativen Beschaffenheit. Die gesonderte Heraushebung der figural-qualitativen Eigentümlichkeiten ist nicht Ergebnis eines unmittelbaren Hinsehens, sondern Ergebnis einer Abstraktion von der Gegenstandsbedeutung, die gleichwohl der dingliche Träger der figural-qualitativen Momente bleibt. (SE 25f)
Auch scheinbar sinnliche Bedürfnisse sind somit über die Ausrichtung der sinnlichen Wahrnehmung auf die gesellschaftliche Einbezogenheit bzw. Verwendbarkeit bereits in hohem Maße produktiv, was sich wiederum in der später kritisierten Spaltung zwischen Produktion und Konsumtion im gesellschaftlichen Prozess widerspiegeln wird.
Die produktive Dimension der Bedürfnisse umfasst also nicht bloß, ob der bewertete Zustand an sich dauerhaft, wiederkehrend bzw. von mir* beeinflussbar ist, sondern auch, wie er sich auf meine* Handlungsfähigkeit insgesamt auswirkt, ob der Zustand des Bedürfnisses und die gewählten Mittel zu seiner Erfüllung also meine* Handlungsfähigkeit auch in Bezug auf meine* anderweitigen Lebensumstände erweitern oder einschränken, sprich, ob ich* mit diesem Zustand etwas anfangen kann.
8.3 Bedürfnisse in Verbindung
8.3.1 Notwendigkeit einer verbindungsorientierten Bedürfniskonzeption
Die Kritische Psychologie nimmt den Standpunkt des Subjekts ein und setzt sich dadurch von der traditionellen Psychologie ab, welche einen fremdbestimmenden Außenstandpunkt zum Subjekt vertritt. Wie in Kapitel 3 hervorgehoben wird, nimmt zumindest Holzkamp dabei aber letztlich eine sehr individualistische Weltsicht ein, was sich in aller Deutlichkeit in dem Apriori der Individualwissenschaft zeigt, daß der Mensch sich nicht bewußt schaden kann (GdP 350, zit. in GL Kap. 11.1).
An diesem Dogma, welches doch unmittelbar die Frage Auch nicht zum Wohle anderer? aufwirft, wird deutlich, dass die Holzkampsche Bedürfniskonzeption eine rein individuelle ist, dass der Mensch bloß eigene Bedürfnisse habe und nach eigenen Bedürfnissen handele.
Dies ist mit der Inklu-Philosophie nicht vereinbar, die eine Weltsicht vom Standpunkt der Verbindung anstrebt. Menschen können nicht bloß nach eigenen Bedürfnissen handeln, sondern auch nach Bedürfnissen anderer; und oftmals lässt sich gar nicht klar zwischen meinen* und euren* Bedürfnissen differenzieren, sodass die sinnvollste Betrachtungsweise darin besteht, dass wir* nach gemeinsamen Bedürfnissen handeln.
Bedürfnisse von Verbindungen ausgehend zu betrachten stellt aber nicht bloß eine andere theoretische Sichtweise dar, sondern erfüllt selbst bereits ein menschliches (Meta-)Bedürfnis, danach, dass sich Bedürfnisse in Verbindungen manifestieren, und ist somit wegweisend für die Konzeption der Utopie. Denn Menschen, und ausschließlich Menschen, sind biologisch angepasst, sich an gemeinschaftlichen Aktivitäten mit gemeinsamen Zielen und gesellschaftlich koordinierten Handlungsplänen zu beteiligen (gemeinsame Intentionen). Interaktionen dieser Art setzen nicht bloß Verständnis von Zielen, Absichten und der Wahrnehmung anderer Personen voraus, sondern zusätzlich auch eine Motivation, diese Dinge in Interaktion mit anderen zu teilen[.][3] (Tomasello et al 2005)
8.3.2 Relative und absolute Verbindungsbedürfnisse
Wir unterscheiden daher Individualbedürfnisse und Verbindungsbedürfnisse, und wir tun dies gleich auf zwei Ebenen, nämlich auf Ebene des Individuums und auf Ebene der Verbindung, wobei wir im ersten Fall von absoluten und in letzterem von relativen Individual- bzw. Verbindungsbedürfnissen sprechen.
- Auf Individuums-Ebene, also in absoluter Bedeutung, bezeichnen Individualbedürfnisse nur solche Bedürfnisse, die unabhängig von all meinen* Verbindungen existieren.
- Im relativen Sinn, also auf Verbindungsebene (d.h. bezogen auf eine bestimmte Verbindung), sind Verbindungsbedürfnisse diejenigen Bedürfnisse, die ohne die konkrete Verbindung nicht existieren würden, und Individualbedürfnisse entsprechend alle anderen Bedürfnisse der Beteiligten, welche dann aus Sicht des Individuums wiederum größtenteils absolute Verbindungsbedürfnisse sind, nur eben aus anderen Verbindungen.
Relative Individualbedürfnisse schließen also stets die absoluten Individualbedürfnisse mit ein, und absolute Verbindungsbedürfnisse schließen die relativen Verbindungsbedürfnisse ein.
Bezüglich der originären (d.h. unmittelbar gegebenen, nicht von anderen Bedürfnissen abgeleiteten) Bedürfnisse soll hier folgende These vertreten werden: Absolute Individualbedürfnisse sind nur die körperlichen (sinnlich-vitalen) Bedürfnisse sowie das abstrakte Bedürfnis nach Verbundenheit als solches. Alle sonstigen (produktiven) Bedürfnisse sind entsprechend (absolute) Verbindungsbedürfnisse, also Bedürfnisse, die erst durch Verbindung entstehen und in die Verbindung gehören, d.h. ihren vollen Befriedigungswert nur entfalten können, wenn sich auch in der Verbindung erfüllt werden. Anders ausgedrückt: Außerhalb von Verbindungen haben Bedürfnisse (bis eben auf das Bedürfnis nach Verbindung) keine produktiven Aspekte. Alle produktiven Aspekte unserer* Bedürfnisse sind Verbindungsaspekte, gehören in eine Verbindung.

Da die Erfüllung in der zugehörigen Verbindung im Exklu-System in aller Regel nicht möglich ist, werden Verbindungsbedürfnisse als Bedürfnisse des Individuums missverstanden bzw. so gelernt, verklärt, reinterpretiert; die Individualsicht wird systemisch aufgezwungen. Das Bedürfnis nach befriedigenden Beziehungen erscheint dann als eins von vielen Bedürfnissen des … Individuums. Solidarische Beziehungen, freie und gleiche Assoziationen, stellen allerdings kein Bedürfnis dar, das den Individuen lediglich noch hinzugefügt werden müsste. Stattdessen befriedigen die Menschen in der wirklichen Gemeinschaft ihre zentralen Bedürfnisse in und durch ihre Assoziation. (BR 271)
Bis auf die sinnlich-vitalen Bedürfnisse und das allgemeine Bedürfnis nach Verbundenheit hat das (rein hypothetische) isolierte Individuum also keine konkreten (originären) Bedürfnisse, sondern solche existieren nur in Verbindung, und in jeder Verbindung hat das Subjekt eine separate Bedürfniswelt. Ich* erfülle in jeder Verbindung eine (wie weit auch immer gefasste) Rolle, die ein eigenes Universum an Wollensdispositionen mit sich bringt; ich* habe dort also separate Bedürfnisse, sowohl was mein* Bestreben als auch was mein* Befinden angeht.
Vor diesem Hintergrund ist die überwiegende Erscheinung der Bedürfnisse im Kapitalismus in Form von Individualbedürfnissen als gesellschaftlich konstruiert zu entlarven: Es wird hier so getan, als wären sämtliche Bedürfnisse nach konkreten Dingen bzw. Handlungen bereits in den Individuen vorhanden, und diese würden mit ihren Bedürfnissen bloß (auf dem Markt) zusammentreffen, um dort entsprechende Beziehungen einzugehen, wo ihre Bedürfnisse zueinander passen. Dies ist aber keine natürliche Gestalt der Bedürfnisse, sondern es ist den Menschen lediglich aufgezwungen, ihre Bedürfnisse so darzustellen.
8.3.3 Herausbildung von Verbindungsbedürfnissen
Bedürfnisse in Verbindung werden durch die Wünsche und Visionen der Individuen bedingt (siehe gleich). Sie bilden sich in ihrer zutiefst eigenen Form aber erst durch die spezielle soziale Dynamik ab, die sich erst in der Verbindung (und ihrer Vermittlung) entwickelt. Sie können damit vielfältiger Natur sein und sich auf Dinge beziehen, die niemand der Beteiligten sich allein hätte vorstellen können. Von daher ist es unmöglich, von den Individuen ausgehend abschließend vorherzusagen, was sie wohl für Bedürfnisse in Verbindung entwickeln würden.
Die relativen Individualbedürfnisse sind Bedürfnisse in anderen Verbindungen und bestimmen mit über die gemeinsamen Verbindungsbedürfnisse. Die Verbindungsbedürfnisse zerfallen aber deshalb nicht – auch nicht teilweise – in Individualbedürfnisse aus anderen Verbindungen, sondern sie erhalten (im doppelten Sinne) stets ihre höchst eigene Qualität.
Die konkrete Natur des Bedürfnisses hängt also stets von der sozialen Dynamik der Verbindung ab. Es lassen sich jedoch einige Bedürfnisse festmachen, die sich bei geschickter Vermittlung definitiv herausbilden würden: Wo die Individualbedürfnisse inklusionslogisch zusammenpassen, wird sich auch ein entsprechendes Verbindungsbedürfnis bilden; die (passenden) Individualbedürfnisse werden also, sobald das gegenseitige Bewusstsein für sie entsteht, zu Verbindungsbedürfnissen aufgehoben.
Wenn ich* also meine* Bedürfnisse im Einklang mit euren* erfüllen kann und wir* uns* darüber bewusst werden, dann haben wir* fortan nicht mehr bloß unsere* (kompatiblen) Individualbedürfnisse, sondern wir haben automatisch das konkretere Verbindungsbedürfnis, unsere* Bedürfnisse auch genau auf diese Weise, also in Verbindung zu erfüllen (ein Bedürfnis, welches das System uns oftmals zwingt, zu unterdrücken).
Ein Verbindungsbedürfnis kann unterschiedlich stark konkretisiert sein, d.h. auf der einen Seite auf eine recht klar bestimmte Tätigkeit bzw. Erfahrung gerichtet sein, und auf der anderen Seite erst noch auf die gemeinsame Exploration des Bedürfnisses selbst (ebenso wie seine Erscheinungsform als Wunsch auf Seite des Individuums, die in Kürze diskutiert wird).
8.3.4 Zwischenfazit
Das Konzept Bedürfnis in Verbindung ermöglicht uns eine völlig neue Sichtweise sowohl auf Bedürfnisse als auch auf Verbindungen: Bedürfnisse sind demnach nicht etwas, das ich* will, sondern es gibt immer ein wir*, das will; selbst wenn das System letztlich nur eine Befriedigung in Vereinzelung erlaubt.
Verbindungen, auf der anderen Seite, haben nicht bloß Bedürfnisse; die Bedürfnisse der Verbindung sind die Verbindung. Dies allerdings nicht nach dem üblichen Verständnis von gemeinsamen Zielen, die zusammenhalten – denn solche wären als relative Individualbedürfnisse der Verbindung äußerlich und würden die Verbindung zu einer reinen Zweckverbindung degradieren –, sondern nur innerhalb der Verbindung ist das gemeinsame Bedürfnis als solches real und konstituiert somit eine durch die Verbindung einzigartige Lebensqualität;
8.3.5 Beispiele
Um das Prinzip Bedürfnisse in Verbindung zu veranschaulichen, nehmen wir wieder mal ein Extrembeispiel: Die Markt-Beziehung, wobei hier zuerst der Arbeitsmarkt, und dann der noch extremere Fall des Warenmarktes betrachtet werden soll.
Arbeitsmarkt
Nehmen wir also an, ich* nehme eine Lohnarbeit auf, und zwar nicht aus Spaß an der Sache, sondern weil ich* das Geld brauche. Dann wird zwischen mir* und euch* als Arbeitgebenden (womit das gesamte Arbeitsumfeld gemeint ist) sicherlich keine sonderlich tiefe Verbindung bestehen; wir* treffen zusammen, nicht vorrangig zur Befriedigung gemeinsamer (Verbindungs-)Bedürfnisse, sondern mit je unseren* relativen Individualbedürfnissen: Meinem* Bedürfnis nach Geld, und eurem* Bedürfnis nach meiner* Arbeitsleistung.
Trotzdem ist unsere* Beziehung bei weitem nicht verbindungslos: Wir teilen prinzipiell auch gemeinsame Interessen, nämlich die an der Qualität meiner* Arbeitsleistung; dabei resultiert euer* Interesse primär aus dem Wert der Leistung für das Unternehmen, und meins* primär aus der Steigerung meines* Ansehens und meiner* Karrierechancen. Das gemeinsame Interesse resultiert aber teilweise (hoffentlich) auch aus gemeinsamen Gründen, wie der Begeisterung für das Fachgebiet, bzw. zumindest dem (durch unsere* Community konstruierten) Sinn für die gute Leistung. Insoweit stellt die Arbeitsleistung hier ein Verbindungsbedürfnis dar: Ein Bedürfnis, das ohne die Verbindung nicht existieren könnte, und nur in der Verbindung befriedigt werden kann.
Das Inklu-Potenzial besteht also in dem Bedürfnis nach Geld und Karriere auf der einen und dem nach Verwertung der Arbeitsleistung auf der anderen Seite, die durch die Organisation von Unternehmen und Arbeitsmarkt insoweit kompatibel sind, als dass Arbeitende bei gut verwertbarer Arbeitsleistung mit Aufstiegschancen zu rechnen haben. Das Verbindungsbedürfnis entsteht dann durch die Leistungskultur, bei der Arbeitende und Arbeitgebende das Bedürfnis nach guter Arbeitsleistung als gemeinsames Bedürfnis adaptieren. Realisiert werden kann das Inklu-Potenzial dann aber nur, soweit es den Arbeitenden tatsächlich möglich ist, ihr Leistungspotenzial zu entfalten.
Wird das Arbeitsverhältnis beendet und versuche ich*, dieselbe Qualität, die ich* dort gelernt habe, in einem neuen Arbeitsverhältnis beizubehalten, dann hängt die dadurch erreichbare Befriedigung davon ab, wie sehr die neuen Arbeitgebenden mit der ursprünglichen Community verbunden sind, bzw. wie sehr sie Teil der alten Verbindung sind; denn dies bestimmt darüber, wieweit ich* das Bedürfnis aus der Verbindung in der Verbindung anstatt in relativer Vereinzelung erfüllen kann.
Warenmarkt
Auf dem Warenmarkt ist die Situation noch extremer, da hier zwar auch – aus offensichtlichen Gründen – die Verkaufenden und ich* ein gemeinsames Bedürfnis nach einer hohen Qualität des Produktes haben, ich* hierauf aber diesmal kaum Einfluss nehmen kann. Diese Ansicht lässt sich relativieren, wenn wir all die anderen Kaufenden in die Verbindung mit einbeziehen – diese haben ja gleichermaßen ein Bedürfnis an der Qualität des erworbenen Produktes. Dann kann ich* sehr wohl, z.B. durch das Verfassen einer Rezension, Einfluss auf die Qualität nehmen. Diese dient zugleich natürlich auch den Verkaufenden als Feedback und somit gleichermaßen ihrem Bedürfnis nach Verbesserung des Produktes oder des Service.
Aber auch die Konkurrenz kann in die Verbindung mit einbezogen werden; auch sie ist an einer entsprechenden Verbesserung ihrer Produkte interessiert, und ich* ebenso, da ich* ja stattdessen bei ihnen kaufen könnte; und auch sie profitieren von dem (öffentlich sichtbaren) Feedback an die Verkaufenden.
Die Verbindung so gedacht, wird klar: Das Bedürfnis (nach der Qualität gleichartiger Produkte im allgemeinen sowie den besonderen Features des von mir* ausgesuchten Modells) würde ohne die Verbindung nicht existieren, und es kann nur in der Verbindung befriedigt werden.
Werbung
Und selbst wenn ich* mich* als Individuum in Vereinzelung befinde und einen Werbespot sehe, der bei mir* gewisse Bedürfnisse auslöst, die sich grob zusammengefasst als Bedürfnis nach dem beworbenen Produkt beschreiben lassen, so handelt es sich hierbei dennoch um Bedürfnisse in Verbindung. Die Verbindung besteht mit den Menschen, die sich das Produkt und den Werbespot ausgedacht haben, denn sie werden das ja (auch) getan haben, weil sie auf gewisse Weise dieselben Bedürfnisse empfinden, und sie haben es geschafft, diese Bedürfnisse mir* gegenüber ansprechend zu kommunizieren und zu vermitteln. Zwar hatte ich* persönlich bei der Entstehung dieser Bedürfnisse nichts mitzureden, dennoch war ich* irgendwie in verallgemeinerter Weise daran beteiligt, da Produkt und Werbespot ja nur entwickelt wurden, weil es Leute wie mich gibt. Die Verbindung besteht daher auch gleichzeitig mit all den anderen Menschen, für die der Werbespot gemacht war und die sich durch ihn angesprochen fühlen (sollen).
Somit existiert das Bedürfnis nur in Verbindung; das heißt aber noch nicht, dass es auch in Verbindung befriedigt werden kann, und gerade das ist ja hier nicht der Fall: Daran hindern uns* (also die Werbetreibenden und die durch die Werbung angesprochenen Menschen) die systemischen Zwänge, insbesondere das Privateigentum und die Verwertungslogik der Konzerne; ich* kann nicht gemeinsam mit den Werbetreibenden an der Erfüllung unserer gemeinsamen (durch den Werbespot vermittelten) Bedürfnisse arbeiten (also z.B. ein Produkt wie das beworbene herstellen), und wir* können nicht gemeinsam in den Genuss dieser Erfüllung kommen, obwohl wir doch alle dieselben Bedürfnisse haben; Nur der Konzern produziert (vereinzelt), und nur ich* kann mich – höchstens vereinzelt – einer somit verkümmerten Version der Bedürfnisbefriedigung zuwenden, und selbst hierfür wird eine (monetäre) Gegenleistung erpresst.
Dass es sich um ein Bedürfnis in Verbindung handelt, bedeutet nicht, dass es überhaupt nicht in Vereinzelung befriedigt werden kann; die Befriedigung muss dann aber immer auf einem prekären, verkümmerten Niveau verbleiben.
8.4 Wünsche, Ziele und Visionen
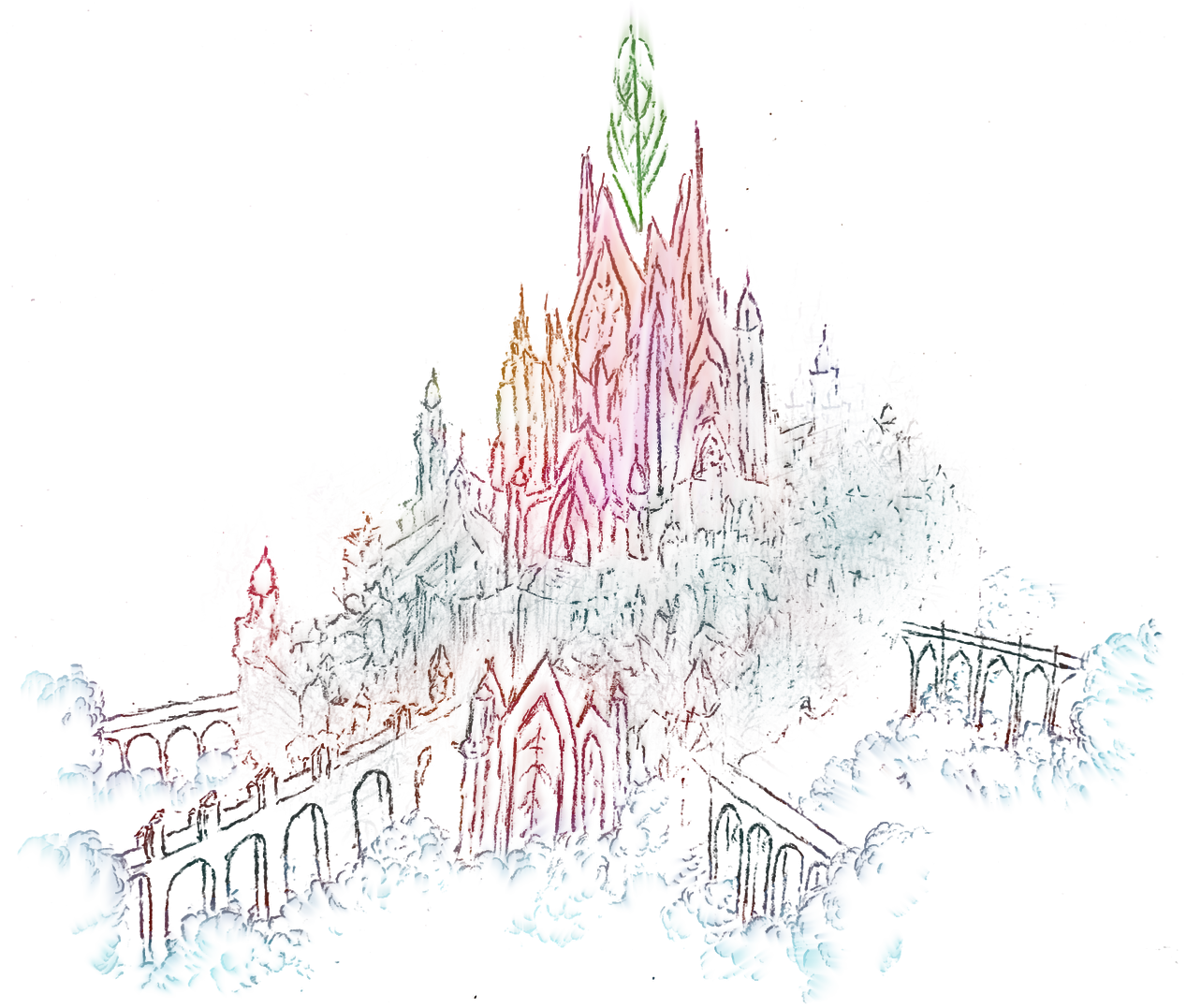
Nachdem wir allgemein Bedürfnisse in Verbindung definiert haben, wollen wir uns nun anschauen, wie sich diese Bedürfnisse für das Individuum darstellen, also für die Beteiligten, wenn sie sich nicht in der Verbindung befinden. Ihnen erscheinen die Bedürfnisse dann als abgeleitete Individualbedürfnisse, welche sich im Konkreten in Form von Wünschen, Zielen oder Visionen darstellen können.
8.4.1 Abgeleitete Individualbedürfnisse
In abgeleiteter Form werden die Bedürfnisse als Individualbedürfnisse erlernt und in Bezug auf andere Verbindungen generalisiert. Diese abgeleiteten Individualbedürfnisse resultieren aus einer Erwartungsbildung im Hinblick auf das Individualbedürfnis nach Verbundenheit aufgrund der durch Verfolgung der Verbindungsbedürfnisse erlernten Kompetenzen. Wir hatten dies zuletzt am Beispiel der Lohnarbeit gesehen, wo das Leistungsbedürfnis und das Bedürfnis nach einer entsprechenden Leistungskultur beim Individuum auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erhalten und dessen Erfüllung im neuen Verhältnis gesucht wird, und konstatiert, dass das Ausmaß der Erfüllung davon abhängen muss, wieweit es noch in derselben Verbindung erfüllt werden kann, also die Kulturen miteinander verbunden sind und ich* damit transpersonal zu den ursprünglichen Arbeitgebenden verbunden bin.
Prinzipiell braucht das Verbindungsbedürfnis nicht selbst erlebt zu werden, sondern es reicht, zu wissen, dass es sich um ein typisches Verbindungsbedürfnis handelt, um zur Kompetenzentwicklung zu motivieren, um die allgemeine Verbindungsfähigkeit zu sichern. Es ist ja aber davon auszugehen, dass gerade auf solche Kompetenzen hin trainiert wird, mit denen ich* mich* besonders gut identifizieren kann, die ich* also bereits als Verbindungsbedürfnisse adaptiert habe. Insofern wäre diese Vorbereitung auch bereits als Streben nach Erfüllung bestehender Verbindungsbedürfnisse zu werten.
Ich* habe dann (sofern nicht tatsächlich ein entsprechendes Verbindungsbedürfnis besteht) ein abgeleitetes Bedürfnis danach, dass in der einer konkreten Verbindung (hier den neuen Arbeitgebenden) oder in meinen* Verbindungen im Allgemeinen gewisse Dinge geschehen, weil das eben Dinge sind, mit denen ich* schon vertraut bin und gut umgehen kann. Hierbei handelt es sich aber nicht um ein originäres Bedürfnis, sondern bloß um ein Mittel zum Zweck meines allgemeinen Individualbedürfnisses nach Verbundenheit, da ich* nur Verbundenheit erfahren kann, wenn ich* auch in der Lage bin, zur Erfüllung der Bedürfnisse in Verbindung beizutragen.
Wie angesprochen, können Bedürfnisse unterschiedlich stark konkretisiert sein. Für die Verbindungsbedürfnisse galt dies, weil das Bedürfnis auch gerade erst in der gemeinsamen Erforschung des Bedürfnisses liegen kann; bei abgeleiteten Individualbedürfnissen ist dies hingegen der Fall, da sie bloß Mittel zum Zweck der Verbundenheit an sich darstellen und als solche von Natur aus nicht konkret zu sein brauchen.
8.4.2 Visionen
Visionen sind konkret, zielen aber nicht auf ihre tatsächliche Erfüllung ab. Es handelt sich dabei um konkrete Vorstellungen der Realisierung von Verbindungsbedürfnissen, die aber als solche (noch) gar nicht existieren müssen, und solange kann in dem Sinne auch nicht davon die Rede sein, dass die Realisierung einer Vision ein Bedürfnis darstellt. Visionen sind also nicht selbst Bedürfnisse, sondern stellen einen Teil der Kompetenz zur gemeinsamen Herausbildung von Bedürfnissen in Verbindung dar.
Die Visionen der Einzelnen erhalten ihren Wert schließlich erst dadurch, dass ihnen ein sozialer Kontext (die Verbindung) hinzugefügt wird, der selbst noch nicht in ihnen enthalten ist, wobei die Vision hier selbst mehr oder weniger bedeutsam sein kann, der Wert also auch ausschließlich in dem noch auszufüllenden sozialen Kontext liegen kann. Das konkrete Bestreben richtet sich auf das Geschehen, wie es tatsächlich stattfindet, also in der konkreten Verbindung; wie und warum dieses Geschehen erstrebenswert ist, kann subjektiv verschieden interpretiert werden, aber aus Inklu-Perspektive existieren tatsächlich intersubjektive Gründe, warum es aus Sicht der Verbindung erstrebenswert ist (bzw. nicht ist).
Eine Vision stellt also einen Plan zur Realisierung eines Verbindungsbedürfnisses dar, falls es denn so entstehen sollte, nicht aber einen Wunsch, dass solche Verbindungsbedürfnisse überhaupt erst entstehen. Dies ist jedoch in gewissem Ausmaß über die Kompetenzbedürfnisse (also die oben erwähnten Bedürfnisse, die eigenen Kompetenzen nutzen zu können) stets der Fall, da Visionen insofern eine Kompetenz darstellen, da das Verständnis der Situation und die eigene Handlung im Geiste trainiert wurden.
Es sei darauf hingewiesen, dass Kompetenzbedürfnisse nur in beschränktem Ausmaß aktiv realisiert werden können, da ihre Realisierung ja gerade außerhalb der Sphäre des Individuums liegt. Ich* kann höchstens darauf hoffen, in einen sozialen Kontext hineinzugeraten, wo ich der Tendenz nach meine Kompetenzen (und damit auch meine Visionen) einbringen kann; die (quasi erzwungene) Herstellung eines solchen Zustands muss den erzielten Zustand aber zu meinem Zustand machen, der Natur seiner Verbundenheit entreißen und damit in individualistischer Weise verkümmern lassen. Trotzdem wäre es falsch zu sagen, dass die Realisierung dieser Bedürfnisse quasi von Natur aus ein by-product darstellen muss (i.S.v. Jon Elster, siehe Fn. 1); vielmehr wird dieses Bedürfnis durch die Verbindungsbedürfnisse überlagert, also unwichtig, soweit tatsächliche Verbindungsbedürfnisse bestehen. Soweit dies nicht der Fall ist, wäre aber von einer fortschrittlichen Gesellschaft zu erwarten, dass sie gerade diese Bedürfnisse fördert (indem sie hilft, entsprechende Verbindungen herzustellen), wodurch sie dennoch direkt verfolgt werden können.
Auch in unserer Community haben sich bestimmte Kollektivbedürfnisse entwickelt. Indem ich dies hier schreibe, trage ich gleichzeitig zur Formung und Erfüllung dieser Kollektivbedürfnisse bei, sowie zu meinem eigenen, allgemeinen Individualbedürfnis nach Verbundenheit, sowie meinen relativen Individualbedürfnissen. Die Visionen, die ich hier aufschreibe, sind selbst noch nicht meine Bedürfnisse, entspringen aber aus unseren Kollektivbedürfnissen und den Bedürfnissen aus meinen anderen Verbindungen, und dadurch auch meinen abgeleiteten Individualbedürfnissen, da ich eben die Gedankengänge beschreibe, die für mich besonders gut funktionieren, und es somit für mich erleichtern, mit euch in Verbindung zu treten.
8.4.3 Ziele
Bei einem Ziel handelt es sich um eine Vision, die nicht bloß handlungsleitende Wirkung hat, sondern deren exakte Umsetzung angestrebt wird. Ziele stellen somit eine verkürzte Sichtweise dar, bei welcher das Handeln nicht mehr an den eigentlichen Bedürfnissen ausgerichtet wird, sondern das Ziel einen Wert an sich darstellt.
Durch die Zielform können die Vorstellungen eine Eigenmacht über die Menschen entwickeln (Fetischisierung). Wer sich Zielen verschreibt, operiert fortan auf einem eingeschränkten (restriktiven) Niveau der Denk- und Handlungsfähigkeit, indem die Hinterfragung der Ziele sowie die Einbeziehung der Bedürfnisse derjenigen, auf deren Kosten die Verfolgung des Ziels evtl. gehen könnte, nicht mehr zur Diskussion steht.
Es ist sowohl die Individualisierung als auch die Fetischisierung, die an der Zielform problematisch sind. Dabei folgt die Individualisierung notwendigerweise auch aus der Fetischisierung, denn wenn wir* zulassen, dass unsere Bedürfnisse erst in Verbindung noch geformt werden, dann können diese logischerweise noch nicht auf konkrete Ziele fixiert sein.
Ziele werden vermutlich unvermeidbar sein, da sie eine Notwendige Heuristik aufgrund kognitiver Beschränktheit darstellen, also notwendigerweise Teil der Definition der Situation (diskutiert in Kapitel 3) werden. Wichtig ist aber, dass die Möglichkeit bestehen bleibt, einmal gesetzte Ziele wenn angemessen auf einer höheren Ebene zu reflektieren und dann ggf. auch eine Aufhebung zu Verbindungsbedürfnissen zuzulassen.
8.4.4 Wünsche
Anders als ein Ziel ist ein Wunsch eine Vorstellung eines Verbindungsbedürfnisses aus Sicht des Subjekts oder aus Sicht einer kleineren Verbindung, die Teil der größeren ist. Er ist nicht das Bedürfnis an sich und auch keine konkrete Vorstellung seiner Erfüllung, sondern kann lediglich handlungsleitende Wirkung zur Erfüllung tatsächlicher Bedürfnisse annehmen. Ein Wunsch kann also nicht an sich, also durch das bloße Wirklich-Werden einer Vision, realisiert werden.
Bei der Wunschform wird in jeder Verbindung mitgedacht, dass sie Teil größerer Verbindungen ist, und dass ihre Verbindungsbedürfnisse aus Sicht anderer Verbindungen bloß Wünsche darstellen können. Gegenüber anderen Verbindungen vertreten die Subjekte die Verbindungsbedürfnisse als Wünsche, sie dienen dazu, sich anhand des Kontakts mit anderen Verbindungen zu entwickeln: Die Bedürfnisse sind in der ursprünglichen Verbindung nicht fertig geformt, sondern der Formungsprozess findet noch im Kontakt der Subjekte (und entsprechend der Vermittlung und Vereinigung, s. später) statt.
Dem Wunsch, zugleich als kommunikatives Mittel wie als Zugang zu den eigenen Bedürfnissen, wird aber nicht selten eine unmittelbare Bedürfnisqualität zuteil, indem nämlich durch Kommunikationsmöglichkeit des Wunsches die Verfügungsmöglichkeiten zur Befriedigung der tatsächlichen Bedürfnisse hergestellt werden und damit gleichzeitig ein in diesem Sinne produktives Bedürfnis realisiert wird.
Gegenüber Visionen und Bedürfnissen haben Wünsche also das zusätzliche befriedigende Element der Reflexion über die Realisierungsform: Bedürfnisse können sich auch in meiner* Wahl zwischen Alternativen zeigen, die mir* spontan angeboten werden, während einem Wunsch eine bewusste selbstständig-kognitive Formulierung vorausgeht.
Betrachten wir einmal, durch welche produktiven Bedürfnisse wir* im Falle der Erfüllung eines Wunsches Befriedigung erfahren können: Dies geschieht primär über das Wissen, das wir* über die Umstände erhalten, die zur Erfüllung des Wunsches geführt haben, also dadurch, dass die Betreffenden kommunizieren, was es für sie bedeutet, aus welcher Motivation heraus sie den Wunsch erfüllt haben.
Unmittelbar bedeutsam ist zunächst, inwiefern die zugrundeliegende Motivation inklusionslogisch war, da dies entscheidend für die Qualität der Verbindungen und das gegenseitige Vertrauen ist. Dies steht im Zusammenhang mit den in Kapitel 5 diskutierten Konzepten der Dispositionsoffenbarung und der Spirale des Vertrauensverlusts: Wenn ihr* euch* dafür aufopfern musstet, meinen* Wunsch zu erfüllen, dann ist die vorsorgende Erfüllung meiner* Bedürfnisse geschwächt!
Hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, dass nun auch die Kommunikation des Bedürfnisses selbst mit einbezogen wird, es also nicht bloß um die grundsätzliche Dynamik der Verbindung geht, sondern auch darum, ob es gelingt, Individualbedürfnisse als Wünsche zur Herausbildung von Verbindungsbedürfnissen zu kommunizieren und dadurch Exklusionsvermeidungsstrategien nicht bloß ihren naiven pragmatischen Wert haben, sondern der Erhaltung der Verbundenheitsqualität gemeinsamer Bedürfnisse dienen.
Hinzu kommt aber auch der Aspekt der Inspiration, insoweit die Motivation und die konkrete Ausgestaltung über die eigene Vorstellung hinausgehen und so das eigene Bestreben verändern bzw. erweitern; wir* lernen hier also neue erstrebenswerte Dinge kennen, was dem in Kapitel 1 aufgeführten Verbindungstyp über Empfehlungen entspricht. Bei Empfehlungen geht es also nicht darum, ein Individualbedürfnis von einer Person auf eine andere zu übertragen, sondern um die Herausbildung eines Verbindungsbedürfnisses auf Grundlage eines Individualbedürfnisses, was, wie später dargelegt, zur vollumfänglichen Erfüllung dann auch die Vereinigung der Verbindungen mit sich ziehen muss.
In dem Maße, wie die konkrete Ausgestaltung tatsächlich die Erwartungen übertrifft, tritt dann eine doppelte Befriedigung ein, nämlich nicht nur durch die Erweiterung des Bestrebens an sich, sondern auch dadurch, dass ja bereits bekannt ist, dass und aus welcher Motivation heraus den anderen die Erfüllung dieses Bestrebens nahegelegt ist.
Schließlich ist noch ein entscheidender Punkt, dass auch ihr* durch die konkrete Ausgestaltung einen Teil eures* eigenen Bestrebens offenbart – und zwar sehr wahrscheinlich in inklusionslogischer Weise, da euch* mein* damit verbundenes Bestreben ja bereits bekannt ist – und mir* so produktive Möglichkeiten verschafft, eure* Interessen zukünftig noch besser mit einzubeziehen.
Der Wunsch als abstraktes Konzept der Manifestierung von Bestreben kann nun auf all diese Ebenen in unterschiedlichem Ausmaß abzielen. Er kann insbesondere auf sinnlich-vitaler Ebene extrem vage sein, um dafür eine Fülle an Informationsgewinn über Motivation und Bestreben unserer* Verbindungsmenschen zuzulassen.
Jon Elster setzt sich in seiner kritischen Diskussion der Visionen von Karl Marx (MSM) unter anderem auch mit dem kreativen Schaffensprozess auseinander, welcher einen integralen Bestandteil des Lebens jedes kommunistischen Individuums darstellen müsse. Ihn beschäftigt die Frage, wie weit die kreative Selbstentfaltung tatsächlich (individuell und für alle Menschen) möglich wäre, und ob sie dann auch tatsächlich zur persönlichen Erfüllung führen würde (dies wird in Kapitel 15 noch ausführlich diskutiert).
Schauen wir uns den großen Künstler oder Wissenschaftler an, der im Laufe seines Lebens todunglücklich ist, weil er einerseits nicht anders kann, als zu tun, was er tut, aber andererseits darunter leidet, den Standard, den er sich selbst setzt, nicht erreichen zu können. Es ist gerade seine große Schöpfungskraft und Erkenntnis, die ihn dazu befähigt, weitaus mehr als andere zu erkennen, wie weit seine Werke sein Ideal verfehlen. Sein Werk mag als ewige Errungenschaft der Menschheit fortbestehen, obgleich sein Leben durch subjektives Elend geprägt sein mag.[4] (MSM 86)
Die subjektive Unzufriedenheit rührt hier aber gerade daher, dass die Ideen der Kreativschaffenden nicht von der Gesellschaft aufgegriffen werden; das vergeblich angestrebte Ideal ist eine Vorstellung, die der Welt kommuniziert werden will, und die von dieser nach dem allgemeinen Prinzip der Herausbildung von Bedürfnissen in Verbindung realisiert werden soll; das Ideal (die Vision) ist also kein Individualbedürfnis der*s Künstler*in, sondern eigentlich Triebkraft zur Entwicklung eines Bedürfnisses in Verbindung mit anderen, genauso wie das Schöpfungsbedürfnis selbst natürlich kein Individualbedürfnis ist, sondern in Verbindung zu anderen existiert, aber von den Schöpfenden nur in Vereinzelung verfolgt werden kann, und damit prekär befriedigt bleiben muss. Es ist nicht das Wahr-Werden des Ideals, das die Kreativperson anstrebt, sondern das Verständnis und Aufgreifen durch die Gesellschaft, damit diese noch höhere Ideale realisieren kann, als sie selbst sich erdenken könnte.
Anders als Ziele, die exklusionslogischer Natur sind, indem klar gewinnt, wer die eigenen durchsetzen kann, und verliert, wer nicht, kann mit einem Wunsch wesentlich freier umgegangen werden: Wir* können uns* fragen: Woher kommen diese Wünsche? Welche Alternativen gibt es? usw.
Fußnoten
- Der Begriff des by-products wurde von Elster (SG, Kap. II) eingeführt, um darauf aufmerksam zu machen, dass sich viele erstrebenswerte Zustände nicht dadurch herstellen lassen, dass sie aktiv, willentlich verfolgt werden, sondern bloß indirekt durch die Verfolgung eines anderen Ziels zustande kommen. ↩︎
- Bei H.-Osterkamp verschwimmt diese eigentlich recht klare Trennung, indem sie den sinnlich-vitalen Bedürfnissen neben den organischen Bedürfnissen auch die Sexualbedürfnisse zurechnet bzw. zwischen einem
Funktionskreis Lebenssicherungund einemFunktionskreis Fortpflanzungunterscheidet (ebd: M II, 22f), wobei unklar bleibt, welche Bedürfnisse genau den jeweiligen Funktionskreisen zuzurechnen wären. Von dieser Trennung und den einhergehenden Komplikationen soll hier abgesehen werden. ↩︎ - Engl. Orig.: [H]uman beings, and only human beings, are biologically adapted for participating in collaborative activities involving shared goals and socially coordinated action plans (joint intentions). Interactions of this type require not only an understanding of the goals, intentions, and perceptions of other persons, but also, in addition, a motivation to share these things in interaction with others[.] ↩︎
- Engl. Orig.: Consider the great artist or scientist who throughout his life is desperately unhappy, because on the one hand he cannot help doing what he does, while on the other hand he suffers from not attaining the standards he sets for himself. It is precisely because of his great power and insight that he is capable, far more than others, of seeing how far his work falls short of that ideal. His work may remain as a lasting achievement of humanity, but his life may have been one of subjective misery. ↩︎
Literatur
BR: Adamczak, B. (2017). Beziehungsweise Revolution: 1917, 1968 und kommende. Suhrkamp, Berlin.
GdP: Holzkamp, K. (1983). Grundlegung der Psychologie. Campus, Frankfurt.
GL: Meretz, S. (2012). Die “Grundlegung der Psychologie” lesen. Einführung in das Standardwerk von Klaus Holzkamp. Norderstedt: BoD.
Verfügbar über grundlegung.de.
KA: Sutterlütti, S.; Meretz, S. (2018). Kapitalismus aufheben: Eine Einladung, über Utopie und Transformation neu nachzudenken. VSA, Hamburg. Verfügbar über commonism.us.
M II: H.-Osterkamp, U. (1976). Grundlagen der psychologischen Motivationsforschung, Bd. II: Die Besonderheit menschlicher Bedürfnisse – Problematik und Erkenntnisgehalt der Psychoanalyse (4. Aufl. 1982). Campus, Frankfurt.
Verfürbar über kritische-psychologie.de.
MSM: Elster, J. (1985). Making sense of Marx. Cambridge University Press.
SE: Holzkamp, K. (1973): Sinnliche Erkenntnis – Historischer Ursprung und gesellschaftliche Funktion der Wahrnehmung. Frankfurt.
SG: Elster, J. (2016): Sour grapes. Cambridge university press.
Buber, M. (1958): Paths in Utopia. London [1949].
H.-Osterkamp (1983): Kontrollbedürfnis. In: Frey, D.; Greif, S. (Hrsg.): Sozialpsychologie. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen. München.
Krisis (1999): Manifest gegen die Arbeit. Online.
Lutosch, H. (2021): „Wenn das Baby schreit, dann möchte man doch hingehen“ – Ein feministischer Blick auf Arbeit, Freiwilligkeit und Bedürfnis in aktuellen linken Utopieentwürfen. Kantine-Festival Chemnitz, August. Manuscript.
Online auf commonaut.de.
Markard, M. (2009): Einführung in die Kritische Psychologie. Argument, Hamburg.
Rubinstein, S. L. (1968): Grundlagen der allgemeinen Psychologie. Berlin [1946].
Tomasello, M.; Carpenter, M.; Call, J.; Behne, T.; Moll, H. (2005).: Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition. Behavioral and brain sciences, 28(5), 675-691.

Hinterlasse einen Kommentar